Dein Warenkorb ist gerade leer!
Schlagwort: Neurotransmitter
-
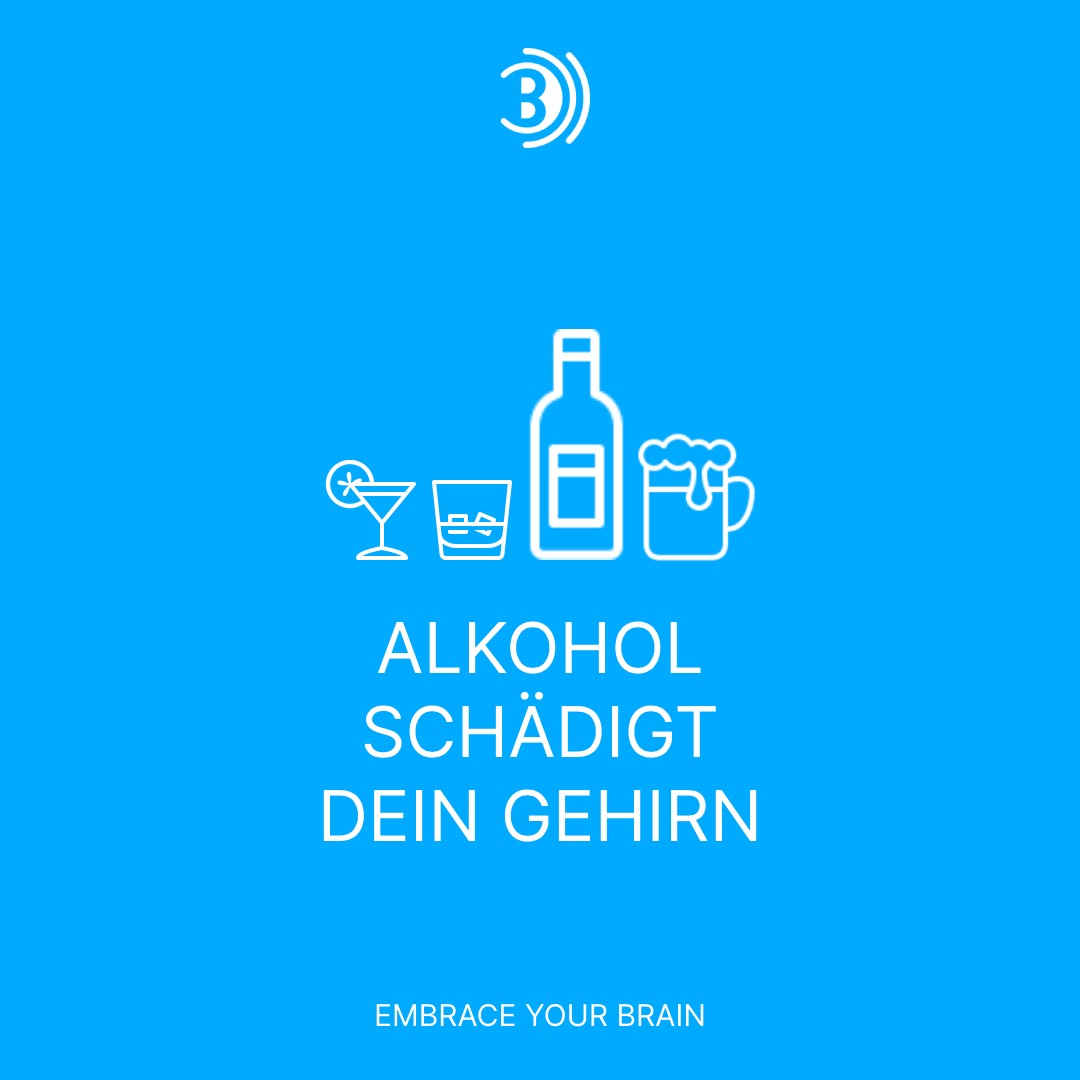
Wusstest du, dass Alkohol dein Gehirn nachhaltig schädigt?
Während ein Glas Wein hier und da allgemein als gesundheitsfördernd angesehen wird, gibt es eine dunkle Seite des Trinkens, die oft übersehen wird. Alkohol kann tatsächlich eine ernsthafte Bedrohung für eines unserer wertvollsten Organe darstellen – unser Gehirn. Warum ist das so? Warum ist Alkohol so gefährlich für unser Denkzentrum? In diesem Blog werden wir die potenziell zerstörerischen Auswirkungen von Alkohol auf unser Gehirn (und unseren Körper) untersuchen und den wissenschaftlichen Grund für diese Gefahr erläutern.
In unserer Gesellschaft gilt es oft als Zeichen von Stärke oder Coolness, wenn jemand viel Alkohol vertragen kann. Das Trinken gehört bei vielen einfach dazu – auf Partys, in geselligen Runden oder sogar im Berufsleben. Wer da nicht mitmacht, wird manchmal belächelt oder als Außenseiter abgestempelt. Doch diese Einstellung hat Schattenseiten: Je mehr wir uns an den regelmäßigen Konsum gewöhnen, desto leichter übersehen wir die langfristigen gesundheitlichen Risiken.
Hinterfragen wir diese Denkweise: Stärke bedeutet nicht, mehr Alkohol zu vertragen, sondern zu wissen, wann es genug ist und auf die eigene Gesundheit zu achten. Es ist vollkommen okay, »Nein« zu sagen und sich für seinen Körper und Geist zu entscheiden. Wenn wir gemeinsam beginnen, den bewussten Umgang mit Alkohol zu normalisieren, können wir nicht nur uns selbst, sondern auch die Gesellschaft um uns herum positiv beeinflussen.

Alkohol – Von der Flasche bis zum Gehirn: Der unerwünschte Begleiter!
Alkohol ist mehr als nur ein gewöhnliches Getränk. Es schleicht sich in uns hinein und zerstört langsam aber sicher unsere wertvollsten Ressourcen – unsere Gehirnzellen! Es ist als würde man das Manuskript seines eigenen Lebens löschen, da der Alkoholkonsum die Fähigkeit, Wissen zu speichern und zu erlernen, einschränkt.
Stell dir vor, du könntest dich mitten in einem Gespräch nicht mehr richtig ausdrücken, fällst ins Lallen oder gar Torkeln. Nicht gerade ein attraktiver Anblick, oder? Das liegt an einer neurochemischen Störung, verursacht durch den Alkohol in unserem System. Alkohol verursacht ein gefährliches Ungleichgewicht unserer Neurotransmitter und verwandelt uns in weniger koordinierte Versionen unserer selbst.

Und das ist noch nicht einmal die ganze Geschichte! Alkohol ist ein wahres Meisterwerk der Zerstörung. Nicht nur hemmt er kurzfristig unsere Glutamatrezeptoren und damit unsere Gedächtnis- und Lernfähigkeit, er hinterlässt auch durch Leberschäden und Vitaminmangel tiefe Narben. Die Leber, unsere superheldenhafte Entgiftungsfabrik, wird durch Alkohol in ihrer Funktionsfähigkeit beeinträchtigt, was zur Ansammlung schädlichen Ammoniaks in unserem Blutkreislauf führt. Das schadet nicht nur den Stützzellen zwischen den Neuronen, sondern greift auch die Nervenzellen im Gehirn direkt an.

Ein Schlummertrunk mit Konsequenzen: So beeinträchtigt Alkohol deinen Schlaf
Außerdem beeinträchtigt Alkohol den Schlaf, weil er das zentrale Nervensystem beeinflusst und dadurch das natürliche Gleichgewicht des Körpers stört. Obwohl einige Menschen Alkohol als Hilfsmittel zum Einschlafen verwenden, führt er tatsächlich zu einer schlechteren Schlafqualität. Alkohol kann dazu führen, dass man öfter aufwacht und einen weniger erholsamen Schlaf hat. Zudem beeinträchtigt er die REM-Schlafphase, die für das Gedächtnis und das Lernen wichtig ist. Daher fühlt man sich nach dem Aufwachen oft nicht ausgeruht und leistungsfähig, auch wenn man ausreichend Stunden geschlafen hat. Alkohol kann somit langfristig Schlafstörungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen.

Der versteckte Einfluss auf unsere Verdauung
Nicht nur, dass Alkohol unsere guten Laune am nächsten Morgen raubt, nein, er verübt auch noch einen Angriff auf unseren Magen-Darm-Trakt und hindert ihn daran, lebenswichtige Nährstoffe aufzunehmen. Denk es dir als würdest du dir selbst die Hände binden und deiner einzigen Nahrungsquelle den Wasserhahn zudrehen. Wir sabotieren uns damit selbst auf die furchtbarste Weise:
Alkohol reizt und entzündet die Schleimhäute im Magen-Darm-Trakt, wodurch unser Körper Nährstoffe aus der Nahrung schlechter absorbieren kann. Er erhöht auch die Produktion von Magensäure, was wiederum Magengeschwüre verursachen kann. Darüber beeinträchtigt Alkohol die Muskulatur des Verdauungssystems, wodurch die Bewegung des Nahrungsbreis durch den Darm verlangsamt wird, was zu Verstopfung führen kann.

Lebe voller Energie – Motivation für eine nüchterne Zukunft
Lass uns jedoch nicht verzagen, denn es steckt eine gewaltige Kraft in uns – die Macht, gesunde Entscheidungen zu treffen! Statt uns durch Alkohol zu schädigen, lass uns die Kontrolle übernehmen und die Weichen auf einen gesunden Lebensstil stellen. Im übertragenen Sinne ist es, als würden wir unsere trockenen Felder bewässern, sodass sie wieder grün und fruchtbar werden können.
Denk daran: Unser Körper ist unser Tempel und wir tragen die Verantwortung für seine Pflege. Betrachte jeden Tag als Chance, etwas Gutes für dich selbst zu tun. Triff bewusste Entscheidungen, die nicht nur dein physisches, sondern auch dein geistiges Wohl fördern.
Wie wäre es, wenn wir unsere Gesundheit in die Hand nehmen und dem Alkohol den Kampf ansagen? Bist du dabei – dein Körper wird es dir danken!

Aber ein bißchen darf schon sein, oder?
Die WHO sagt ganz klar: Es gibt keine Menge an Alkohol, die wirklich »sicher« ist. Selbst ein bisschen Alkohol kann das Risiko für ernsthafte Krankheiten wie Krebs erhöhen. Und wenn du regelmäßig trinkst, steigt die Gefahr, abhängig zu werden. Alkohol schadet nicht nur deiner Leber, sondern kann auch dein Herz, dein Gehirn und dein allgemeines Wohlbefinden beeinträchtigen. Die Empfehlung der WHO: Frauen sollten höchstens ein Standardgetränk pro Tag trinken, Männer maximal zwei. Ein Standardgetränk bedeutet etwa 250 ml Bier, 100 ml Wein oder 30 ml Spirituosen! Auf jeden Fall auf Alkohol verzichten sollen schwangere und stillende Frauen, Menschen mit gesundheitlichen Problemen wie Lebererkrankungen, Personen, die Medikamente einnehmen, die mit Alkohol interagieren könnten, und Menschen, die Auto fahren oder Maschinen bedienen müssen.
Also, achte auf dich und deinen Körper! Es ist an der Zeit, deinen Alkoholkonsum mal genauer unter die Lupe zu nehmen!
Möchtest du mehr über dein Gehirn und wie du wie du mehr aus deinem Supercomputer herausholen kannst, lesen? Dann schau mal hier rein:
Train your Brain – wie du das Beste aus deinem Denkapparat herausholst
Unzerbrechlich: Die Kraft von Resilienz und das Überwinden von Herausforderungen im Leben
Entfessle die Kraft eines fitten Gehirns: Entdecke, wie Bewegung deine geistige Fitness steigert! -

Heute schon gelacht?
Nein, das wird es Zeit! Denn Lachen ist gut für unser Gehirn. Der Neurophysiologe James Olfs hat 1953 das Lustzentrum im Gehirn entdeckt. Es sitzt im Limbischen System, wo unter anderem auch unsere Emotionen gesteuert werden. Diese werden durch Neurotransmittern ausgelöst, zB Endorphine und Encephaline.
Lachen fördert einerseits die Produktion dieser »Glückshormone« und andererseits den Abbau von Stresshormonen wie Corticoide und Catecholamine. Häufiges Lachen hilft aber auch unserem Selbstbewusstsein: Menschen, die viel lachen, erleben sich selbst als kompetent und fürchten sich weniger vor sozialen Konflikten.

Lachen macht nicht nur fröhlich, sondern ist auch gesund.
Wenn wir lachen, atmen wir schneller und tiefer. Dadurch nehmen wir mehr Luft auf, die im Blut durch den Körper gepumpt wird. Das wirkt sich positiv auf unseren Fettstoffwechsel und die Ausscheidung von Cholesterin aus. Das Abfallprodukt Kohlensäure stoßen wir bei der Lachatmung komplett aus. Insgesamt ist der Gasaustausch beim Lachen drei- bis viermal höher als in Ruhe. Zusätzlich massiert die Anspannung des Zwerchfells unsere Eingeweide, wovon unsere Darmaktivität profitiert. Studien haben gezeigt, dass Lachen unser Immunsystem stärkt, Spannungen löst und helfen kann, uns zu entspannen.
Außerdem spannen wir beim Lachen etwa 300 Muskeln an, allein im Gesicht sind es 17. Besonders natürlich die flachen Muskeln, also die Stirn-und Schläfenmuskeln, die Muskeln des Jochbeins und die von Lippen und Augenlidern. Das Lächeln formt übrigens der Zygomaticus-Muskel, der über das Jochbein verläuft und die Mundwinkel nach oben zieht. Wo Stirnrunzeln grisgrämige Falten verursacht, erzeugt Lachen entzückende Falten.

Erwachsene lachen nur etwa 15x am Tag, Kinder allerdings 400x!
Babies lächeln gleich nach der Geburt, aber erst nach 6 bis 8 Wochen ist es ein soziales Wiederlächeln. Babies interagieren schon sehr früh mit ihren Bezugspersonen. Je mehr ein Kind kann, desto besser kann es Humor einsetzen. Kinder haben noch einen spontaneren Humor als Erwachsene, weil die meist erst darüber nachdenken, ob überhaupt gelacht werden darf.
Dabei hilft uns Humor beim Verarbeiten und Bewältigen und dient der Stressreduktion und dem Bedürfnis nach Zuwendung. Lachen ist ein Mittel, die Kommunikation zwischen Menschen freundlich zu machen. Wenn es gelingt, auch in ernsthaften Gesprächen gemeinsam über etwas zu lachen, dann entwickelt sich eine Grundlage der Sympathie. Auch Missverständnisse oder Ärger lassen sich mit humorvoller Distanz besser annehmen, bewältigen und manchmal sogar in Wohlgefallen auflösen. Trotzdem zeigt sich leider immer wieder: Die Menschen lächeln viel zu selten!

»Wir lachen nicht, weil wir glücklich sind – wir sind glücklich, weil wir lachen.«
William JamesEin glücklicher Gesichtsausdruck kann tatsächlich dazu führen, dass wir uns ein bisschen glücklicher fühlen. Bei einer Meta-Studie aus 138 Studien mit über 11.000 Teilnehmern wurde die Facial-Feedback-Hypothese grundsätzlich bestätigt: unser eigener Gesichtsausdruck beeinflusst unsere Gefühlserfahrung, d.h. wir finden Cartoons lustiger, wenn wir beim Anschauen lächeln, und reagieren gefühlvoller, wenn unser Gesicht auch die entsprechende Emotion zeigt – egal ob Glück, Wut oder Trauer.
Humor ist also eine hochwirksame »Psycho-Droge«, aber mit ausschließlich positiven Nebenwirkungen (natürlich nur wenn der Humor nicht abwertend, zynisch oder negativ ist). Im Gehirn wird ein ganzer Schwall von Botenstoffen ausgeschüttet, die mit dem Belohnungszentrum verbunden sind: Endorphine und Serotonin fördern Glücksgefühle und lindern Schmerzen, während die Stresshormone reduziert werden. Laut dem Neurologen Frank Erbgut belohnen wir uns durch das Lachen selbst: »Lachen ist so etwas wie ein kleinen Gehirn-Wellness-Programm.«
Wer braucht nichts davon in unserer geschäftigen und hektischen Welt? Also: nimm dir heute die Zeit und erinnere dich an lustige Erlebnisse und lach was das Zeug hält!

Lachen ist schließlich die beste Medizin, und das ist genau das, was der Arzt für ein gesundes und erfolgreiches Leben verschrieben hat!
Mehr über Lachen, wie es hilft und wie in anderen Kulturen gelacht wird, liest du in unserem Blog »Das wäre ja gelacht!«
Möchtest mehr über Humor wissen und wie er dein Leben verändert? Die Psychologin und Humorforscherin Dr. Doris Bach hat ein Braintonic Special für uns gemacht: Braintonic Humor – als Hörbuch oder eBook, exklusiv nur bei uns erhältlich!
Du möchtest auch gern witzig sein und die Lacher auf deiner Seite haben? Dann hol dir unsere »8 Tipps, wie du in Gesprächen ohne Anstregung lustig sein kannst«
-

Ich bin im (Weihnachts-)Stress!
Jeder von uns hat Stress. Klar, denn das gehört zu unserem modernen Leben irgendwie dazu. Besonders in jetzt in der (Vor-)Weihnachtszeit, in der eine Weihnachtsfeier die andere jagt, man drüber grübelt, was man wem schenkt und wie man das besorgen kann, und eigentlich sollte es die stillste Zeit des Jahres sein! Kein Wunder, wenn du nicht mehr weißt, was du zu erst machen sollst und wo dir da der Kopf steht. Aber was ist Stress eigentlich? Hier liest du, welche Arten von Stress es gibt, wie er entsteht und was chronischer Stress in unserem Körper anrichtet.
Stress: Ein Freund oder Feind?
Woher kommt der Begriff Stress?
Was stresst uns?
Reagieren Männer und Frauen unterschiedlich auf Stress?
Was geschieht in unserem Körper, wenn wir Stress haben?
Resilienz und Belohnungssystem: Was Dopamin mit Stress zu tun hat
Chronischer Stress: Mehr als nur intensive Belastung
Von Erschöpfung bis Herzproblemen: Wie chronischer Stress unsere Organe beeinflusstDie Auswirkungen von Stress auf das Gehirn werden durch zwei wichtige Gehirnregionen gesteuert: den Hypothalamus und die Hypophyse. Diese setzen die Stresshormone Adrenalin und Kortisol frei, die unser gesamtes Nervensystem in Alarmbereitschaft versetzen und Energie für kurzfristige Herausforderungen mobilisieren. Dadurch sind wir wacher, körperlich leistungsfähiger und haben eine höhere Schmerztoleranz.
Problematisch wird es jedoch, wenn der Kortisolspiegel durch chronischen Stress dauerhaft erhöht bleibt. Dies kann zu einer Schädigung der Nervenzellen, vor allem im Hippocampus, führen – dem Bereich, der für Gedächtnis und Lernen zentral ist. Ein dauerhaft hoher Kortisolspiegel hemmt die Neubildung von Nervenzellen (Neurogenese) und die Vernetzung im Gehirn, was unsere Lernfähigkeit und geistige Flexibilität beeinträchtigen kann. Außerdem kann chronischer Stress entzündungsfördernde Stoffe (Zytokine) freisetzen, die das Immunsystem belasten, sowie Muskel- und Knochensubstanz abbauen.
Entscheidend ist jedenfalls, wie wir selbst die stressige Situation bewerten und darauf reagieren. Eine einzige Situation kann positiven oder negativen Stress auslösen – und unsere Erfahrungen und gelernten Reaktionen sind oft der Schlüssel. Stell dir vor, du siehst im Park einen großen Hund auf dich zulaufen: Bist du Hundefan, freust du dich vielleicht und freust dich auf das Spiel. Wenn du jedoch schlechte Erfahrungen mit Hunden gemacht hast, spürst du möglicherweise Stress oder sogar Angst. Unsere Erfahrungen und Einstellungen beeinflussen also stark, wie wir Stress erleben und welche körperlichen Reaktionen folgen.

Stress: Ein Freund oder Feind?
Wir unterscheiden grundsätzlich zwei verschieden Arten von Stress:
- Positiver Stress – Eustress
- Negativer Stress – Distress
Eustress hat den Vorteil, dass er uns anspornt, unsere Leistung zu steigern und persönliche Grenzen zu überwinden, ohne dabei zu einem langfristigen Schaden zu führen. Solange wir lernen, diese Stressreaktionen bewusst zu regulieren und die Balance zu wahren, bleibt das Belohnungssystem ein hilfreiches Instrument zur Stärkung unserer mentalen und körperlichen Gesundheit.
Distress ist die negative Form von Stress, die entsteht, wenn wir mit einer Situation konfrontiert werden, die unsere physischen oder psychischen Ressourcen überfordert. Im Gegensatz zu Eustress, der uns motiviert und anspornt, führt Distress zu Überlastung. Distress tritt auf, wenn die Anforderungen einer Situation als bedrohlich wahrgenommen werden und unsere Fähigkeit zur Bewältigung übersteigen. Wenn wir uns hilflos fühlen und keine Kontrolle über die Stressfaktoren haben, wird Stress als belastend erlebt.
Ein Beispiel für Distress ist chronischer Stress, der durch anhaltende Belastungen wie Überarbeitung, finanzielle Sorgen oder zwischenmenschliche Konflikte verursacht wird. Diese Art von Stress kann zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen führen, wie etwa Angststörungen, Depressionen, Schlafstörungen, erhöhter Herzfrequenz oder Bluthochdruck. Der Körper bleibt in einem Zustand der Alarmbereitschaft, was auf Dauer zu einer Schwächung des Immunsystems und einer erhöhten Anfälligkeit für Krankheiten führt.

Woher kommt der Begriff Stress?
Der Vater der Stressforschung Hans Selye beobachtete 1936 während eines Laborversuchs an Ratten, dass sich unter Einfluss von Stress deren Lymph- und Thymusdrüsen veränderten. Er nanntet diese Veränderungen als »Allgemeines Adaptionssyndrom« – eine Art Anpassungsprozess, durch den der Körper auf wiederholte Belastungen reagiert. Selye griff später einen Begriff aus der Physik auf – »Stress« – um eine Herausforderung zu beschreiben, die als Bedrohung wahrgenommen wird, wenn sie unsere Bewältigungsmöglichkeiten übersteigt.
Heutzutage wird Stress breiter definiert. Er kann als äußere Belastung (Stimulus), als körperliche Reaktion oder als Wechselwirkung (Transaktion) beschrieben werden, die sowohl psychische als auch physische Ressourcen eines Menschen in Anspruch nimmt. Solche Belastungen lösen komplexe biologische Reaktionen im Körper aus, die uns kurzfristig aktivieren können, aber langfristig auch belasten:
- Stimulusorientierte Sicht:
Stress wird durch bestimmte Reize, Situationen oder Bedingungsmerkmale ausgelöst. In der Arbeitspsychologie beispielsweise sind Stressfaktoren am Arbeitsplatz u.a. extremer Zeitdruck und Monotonie. Allerdings reagieren Personen unterschiedlich auf denselben Reiz. - Reaktionsorientierte Perspektive:
Stress wird mit Erregung gleichgesetzt, also eine unspezifische Reaktion des Körpers, die von mehr oder weniger globalen Bedingungen ausgelöst wird. - Transaktionale Perspektive:
Stress wird durch ein Ungleichgewicht zwischen den Anforderungen der Umwelt und den Ressourcen des Individuums ausgelöst, wobei das Ausmaß des Stressempfindens durch die individuelle Einschätzung der Bewältigungsmöglichkeiten bestimmt wird.

Was stresst uns?
Stressoren stören von innen oder außen unser Gleichgewicht, und wir brauchen zur Wiederherstellung dieses Gleichgewichts Energie, die wir aber nicht automatisch und unmittelbar verfügbar haben. Es sind also Faktoren, die bei uns mit erhöhter Wahrscheinlichkeit Stress oder Stressempfinden auslösen. Diese Faktoren können von außen kommen – also physische Einflüsse wie Lärm oder extreme Temperaturen – aber auch aus unserem sozialen Umfeld kommen (z.B. Trauer, Isolation, Konflikte). Oder sie haben ihren Ursprung in uns selbst (z.B. Ängste, Ärger oder Misserfolg). Solche Stressoren rufen in uns biologische, psychische und soziale Anpassungsreaktionen hervor: Unser Körper mobilisiert etwa erhöhte Wachsamkeit (Vigilanz), Angst körperliche Aktivität oder sozialen Rückzug – Strategien, die uns helfen sollen, die Belastung zu bewältigen und wieder ins Gleichgewicht zurückzufinden.
Im Alltag treten Stressoren selten isoliert auf. Stattdessen kommen sie häufig in Clustern vor – eine Sammlung kleiner, alltäglicher Belastungen, oft als »daily hassels« bezeichnet, wie Zeitdruck, kleinere Konflikte oder organisatorische Aufgaben. Diese kontinuierliche Anhäufung kann langfristig sogar belastender sein als einzelne größere Lebensereignisse, weil sie unseren Körper und Geist ständig in Alarmbereitschaft halten. Diese Belastungen erhöhen das Risiko für maladaptive Entwicklungen, d.h. ungünstige Anpassungen, die zu chronischem Stress und potenziellen gesundheitlichen Folgen führen können.
Ob und wie Stressoren uns belasten, hängt davon ab, wie wir die Situation wahrnehmen und bewerten. Mehrere Faktoren spielen dabei eine Rolle: wie intensiv und anhaltend die Herausforderung ist, ebenso wie unsere eigene persönliche Verfassung, unsere geistige und körperliche Widerstandsfähigkeit und unsere Fähigkeit uns anzupassen (Resilienz). Unsere Kompetenz, stressige Situationen bewältigen zu können, entwickelt sich maßgeblich in unserer Kindheit und Jugend. Während dieser prägenden Zeit haben sowohl genetische Anlagen als auch die äußeren Umwelteinflüsse – wie Erziehung, soziale Unterstützung und Erfahrungen – entscheidenden Einfluss darauf, wie widerstandsfähig wir später mit Stress umgehen können.

Reagieren Männer und Frauen unterschiedlich auf Stress?
Es gibt viele Studien, die aufzeigen, dass Männer und Frauen unterschiedlich auf Stress reagieren und unterschiedliche Strategien zur Bewältigung entwickeln. Diese Unterschiede zeigen sich schon im Kindesalter, sind aber besonders im Jugendalter stark ausgeprägt. Mädchen neigen dazu, stärker unter Stress zu leiden und zeigen häufigere Stresssymptome als Jungen. Diese erhöhte Anfälligkeit für Stress bei Mädchen könnte durch biologische und gesellschaftliche Einflüsse bedingt sein, zum Beispiel durch hormonelle Veränderungen oder unterschiedliche soziale Erwartungen und Verhaltensnormen.
In Bezug auf die Bewältigung von Stress zeigen sich ebenfalls Unterschiede: Frauen suchen tendenziell eher soziale Unterstützung, teilen ihre Sorgen mit Freunden oder Familienmitgliedern und versuchen, emotionale Nähe und Hilfe zu finden. Männer hingegen greifen oft zu vermeidenden Strategien, wie dem Zurückziehen oder dem Versuch, die stressige Situation zu ignorieren. Diese unterschiedlichen Herangehensweisen können sich auf die Art und Weise auswirken, wie Männer und Frauen langfristig mit Stress umgehen und welche Auswirkungen dieser auf ihre psychische und körperliche Gesundheit hat.

Was geschieht in unserem Körper, wenn wir Stress haben?
Um auf eine Herausforderung zu reagieren, aktiviert unser Körper den sogenannten »Kampf-oder-Flucht«-Modus, der es uns ermöglicht, auf Bedrohungen schnell und effizient zu reagieren. Dieser Prozess wird durch die Aktivierung von drei Haupt-Stressachsen gesteuert, die unsere physiologischen und psychischen Reaktionen beeinflussen:
- Die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse HHNA schüttet Kortisol aus. Es steuert eine Reihe von Funktionen, darunter die Energiezufuhr und die Modulation des Immunsystems. Kurzzeitig fördert Kortisol die Bereitstellung von Energie und kann die Immunfunktion stärken, aber eine langanhaltende Kortisolfreisetzung kann das Immunsystem schwächen und entzündliche Reaktionen fördern.
- Die sympathische Achse SA setzt Noradrenalin sowie Adrenalin frei. Sie versetzen den Körper in Alarmbereitschaft, indem sie die Herzfrequenz und den Blutdruck erhöhen. Diese Reaktionen bereiten uns auf schnelle, körperliche Reaktionen vor und helfen, Schmerzempfindungen kurzfristig zu reduzieren.
- Die dritte Stressachse schüttet Neuropeptide und Zytokine aus. Diese sind Botenstoffe der Immunabwehr. Kurzzeitiger Stress kann die Immunantwort steigern, während chronischer Stress entzündungsfördernd wirkt und die Anfälligkeit für Infektionen und Krankheiten erhöht.
Die Stresshormone und Neurotransmitter beeinflussen eine Vielzahl von Körperprozessen, um uns auf eine mögliche Bedrohung vorzubereiten. Diese Botenstoffe verändern unser Bewusstsein, indem sie unsere Aufmerksamkeit schärfen und uns in Alarmbereitschaft versetzen. Sie steigern die Leistung des Herz-Kreislaufsystems, indem sie die Herzfrequenz und den Blutdruck erhöhen, sodass mehr Sauerstoff zu den Muskeln transportiert wird. Gleichzeitig wird der Tonus der glatten Muskulatur (wie in den Verdauungsorganen) und der Skelettmuskulatur angepasst, um eine schnelle Reaktion zu ermöglichen.
Außerdem fördern diese Neurotransmitter die Sekretion von Schweißdrüsen, um den Körper vor Überhitzung zu schützen, sowie die Verdauungssekretion, um das Verdauungssystem auf die notwendige Energieaufnahme vorzubereiten. Der Energiestoffwechsel wird ebenfalls angeregt, indem Fettsäuren und Zucker mobilisiert werden, die als schnelle Energiequelle dienen, damit wir auf eine akute Herausforderung reagieren können.

Resilienz und Belohnungssystem: Was Dopamin mit Stress zu tun hat
Wenn wir eine Stresssituation erfolgreich bewältigen, reagiert unser Gehirn mit der Ausschüttung von Dopamin, einem Neurotransmitter, der uns mit einem Gefühl der Belohnung und Entspannung belohnt. Dieses Belohnungssystem spielt eine wesentliche Rolle, indem es uns motiviert, herausfordernde Situationen erneut anzugehen. Dopamin fördert ein positives Gefühl von Befriedigung und kann dazu beitragen, dass wir uns nach einer stressigen Situation wieder erholen und regenerieren.
Dieser Mechanismus ist entscheidend für unsere Resilienz, da er uns ermöglicht, nach stressigen Erfahrungen wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Auch wenn es manchmal dazu führen kann, dass wir wiederholt nach herausfordernden Situationen suchen (was in bestimmten Fällen zu einer suchtartigen Verhaltensweise führen könnte), ist das Grundprinzip des »Eustress« – der positiven Form von Stress – gesundheitsfördernd und lebenssichernd.
Wenn eine Stresssituation jedoch nicht erfolgreich bewältigt wird, kann der Körper in einen chronischen Stresszustand übergehen, was zu negativen Folgen für die Gesundheit führt. Anstatt sich zu entspannen und zu regenerieren, bleibt das Stresssystem aktiviert. Dies bedeutet, dass der Körper kontinuierlich hohe Mengen an Stresshormonen wie Kortisol produziert, was auf lange Sicht das Immunsystem schwächt, Entzündungen fördert und den Schlaf beeinträchtigt.
Langfristig führt die Unfähigkeit, Stress zu bewältigen, zu einem Zustand der »Übererregung«, in dem der Körper Schwierigkeiten hat, zwischen echten Bedrohungen und alltäglichen Herausforderungen zu unterscheiden. Dieser Zustand kann das allgemeine Wohlbefinden erheblich beeinträchtigen und dazu führen, dass wir uns erschöpft und überfordert fühlen.
In solchen Fällen kann die ständige Überlastung des Nervensystems die Fähigkeit zur Stressbewältigung verringern und das Risiko für psychische Erkrankungen wie Angststörungen, Depressionen und posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS) erhöhen. Auch die kognitiven Funktionen können leiden, da das ständige Fehlen einer Erholung die Gedächtnisleistung beeinträchtigen und die Lernfähigkeit einschränken kann.

Chronischer Stress: Mehr als nur intensive Belastung
Chronischer Stress entwickelt sich oft schleichend und hat keinen klar erkennbaren Anfang. Er ist das Ergebnis kontinuierlicher Belastungen über längere Zeiträume hinweg, die sowohl geringe als auch intensive Stressfaktoren umfassen können. Wichtig zu verstehen ist, dass es nicht unbedingt die Intensität des Stresses ist, die entscheidend ist, sondern die Häufigkeit und der ständige Aufbau von Belastungen. Ein starker Zusammenhang zwischen den psychologischen und physiologischen Aspekten von Stress existiert, da der mentale Stress nicht nur unser emotionales Wohl beeinflusst, sondern auch direkte körperliche Auswirkungen hat, etwa auf das Herz-Kreislaufsystem oder das Immunsystem.
Zusätzlich gehören zu chronischem Stress auch sogenannte »non-events« – also belastende Erwartungen oder Befürchtungen, die nicht eintreten. Diese fehlenden Ereignisse können den Stress weiter verstärken, da sie das Gefühl der Unsicherheit und mangelnde Kontrolle weiter anheizen. Ein klassisches Beispiel könnte sein, sich ständig Sorgen über bevorstehende Prüfungen oder berufliche Veränderungen zu machen, ohne dass diese in der befürchteten Weise eintreten, was aber dennoch eine erhebliche Belastung darstellt.
Chronischer Stress wirkt sich negativ auf das körperliche Gleichgewicht aus und kann langfristig zu einer Reihe von gesundheitlichen Problemen führen. Dieser fortwährend aktive Stress beeinträchtigt das vegetative Nervensystem und führt zu einer Erschöpfung unserer Ressourcen. Der Körper verliert die Fähigkeit, effizient auf Stresssituationen zu reagieren, was zu einer Schwächung der Stressachsen (HHMA und SA) führt. Das bedeutet, dass die schnelle Bereitstellung von Neurotransmittern, die normalerweise zur schnellen Reaktion auf akuten Stress notwendig sind, gestört wird. Dieser Zustand kann die körperliche Gesundheit stark belasten und zu chronischen Erkrankungen führen, da der Körper ständig in einem Zustand der Alarmbereitschaft bleibt – ohne die nötige Erholung.

Von Erschöpfung bis Herzproblemen: Wie chronischer Stress unsere Organe beeinflusst
Strömen zu viele Reize auf uns ein, reagiert unser Körper mit einer überdimensionierten Alarmreaktion und akuter Erschöpfung. Wenn diese Belastung weiter andauert, wird aus der akuten Belastungsstörung eine Anpassungsstörung. Besonders bei genetisch induzierten Individuen kann die stressinduzierte verstärkte Ausschüttung von Neuropeptiden zu neurogenen Entzündungen in peripheren Organen wie lokale Entzündungsreaktionen mit oxidativem Stress und Schmerzen führen.
Das Chronische Erschöpfungssyndrom (CFS) ist eine langfristige, oft sehr belastende Erschöpfung, die nicht durch medizinische Ursachen erklärt werden kann. Sie dauert mindestens sechs Monate an und wird nicht durch körperliche Anstrengung verursacht. Ruhephasen lindern die Erschöpfung nicht, und Betroffene erleben eine signifikante Reduktion ihrer sozialen und beruflichen Aktivitäten. Eine häufige Folge von CFS ist eine beeinträchtigte Funktion der endokrinen Stressachse, was zu einem Mangel an Stresshormonen wie Kortisol führen kann.
Ein weiteres mit chronischem Stress verbundenes Syndrom ist das Takotsubo-Syndrom, auch bekannt als »Broken-Heart-Syndrom«. Diese stressbedingte Herzerkrankung betrifft häufig Frauen (89,8% der Betrroffenen), besonders postmenopausale. Sie kann zu schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen führen, und in etwa 4,5 % der Fälle endet sie tödlich. Das Takotsubo-Syndrom ist ein weiteres Beispiel dafür, wie stressbedingte Faktoren den Körper auf tiefgreifende Weise beeinflussen können.

Was du gegen (deinen) Stress tun kannst, liest du in unserem nächsten Beitrag: Nie wieder Stress! Bleib dabei!
Du willst deine Resilienz stärken? Klick hier und erfahre, was Resilienz ist und wie du Herausforderungen meistern kannst: Unzerbrechlich: Die Kraft von Resilienz und das Überwinden von Herausforderungen im Leben
-
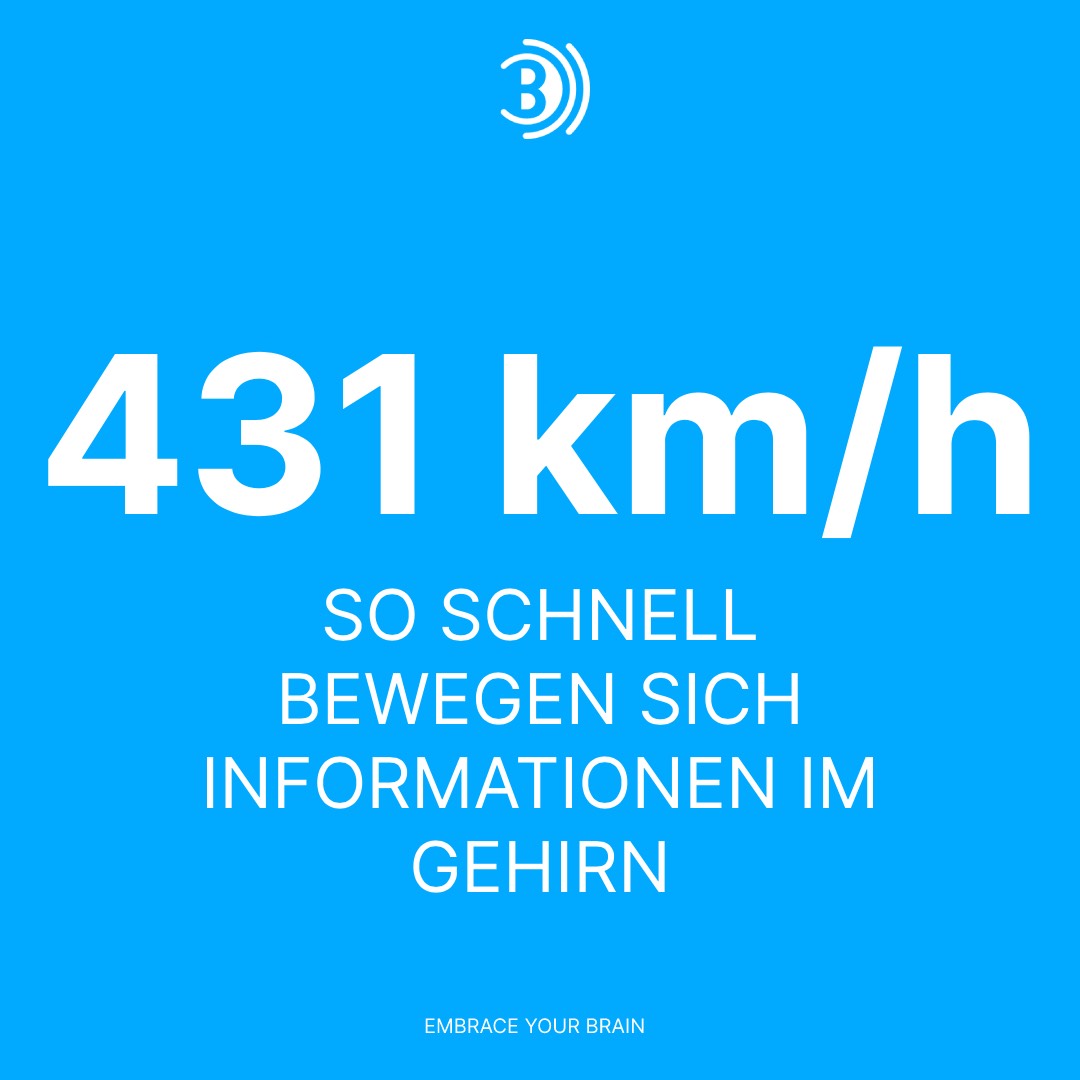
Wusstest du, dass sich Informationen im Gehirn mit 431 km/h fortbewegen?
Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie deine innere Uhr funktioniert? Oder wie du dich an etwas erinnerst, das vor vielen Jahren passiert ist? Das alles sind komplexe Prozesse, die dank der Arbeit von unzähligen Neuronen und Neurotransmittern möglich sind.
Jeder flüchtige Gedanke, den du hast, jede Erinnerung, die du hervorrufst und jedes Gefühl, das du empfindest, ist das Ergebnis einer erstaunlichen Aktivität in deinem Gehirn. In diesem Moment bewegen Milliarden von Neuronen die Informationen deinem Gehirn mit atemberaubender Geschwindigkeit von 120 Metern pro Sekunde (etwa 413km/h). Diese kleinen Zellen sind die Bausteine unseres Nervensystems und ihr schneller und unermüdlicher Betrieb ist das, was unser Gehirn am Laufen hält.

Wie die Informationen weitergeleitet werden
Dieses Gehirn ist ein faszinierendes Netzwerk aus Neuronen, also Nervenzellen. Jede Nervenzelle besteht aus einem Zellkörper, Dendriten und einem Axon. Der Zellkern enthält die DNA und reguliert die Zellaktivitäten, wie die Synthese von RNA und Proteinen. Die Dendriten fungieren als »Empfänger« und nehmen die Signale von anderen Nervenzellen oder Sinneszellen auf, während die Axone sozusagen die »Sender« sind. Diese Signale werden von chemischen Botenstoffen, den Neurotransmittern, übertragen, die von anderen Neuronen freigesetzt werden.
Wenn die empfangenen chemischen Signale stark genug sind, erzeugen die Zellkörper eine elektrische Spannung, die als »Aktionspotenzial« bezeichnet wird. Dieses Aktionspotenzial ist ein schneller Wechsel in der elektrischen Ladung über die Zellmembran des Neurons. Dieser Prozess beginnt am Axonhügel (dem Übergang vom Zellkörper zum Axon) und breitet sich entlang des Axons aus, ähnlich wie ein elektrischer Impuls entlang eines Kabels.

Wovon die Geschwindigkeit abhängt
Die Geschwindigkeit, mit der diese Aktionspotenziale weitergeleitet werden, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ein entscheidender Faktor ist die Myelinscheide, eine Art Isolierschicht um die Nervenfasern. Sie wird von speziellen Zellen (Schwann-Zellen im peripheren Nervensystem und Oligodendrozyten im zentralen Nervensystem) gebildet und ermöglicht es dem Aktionspotenzial, schneller zu reisen, indem es von einem Ranvier’schen Schnürring (kleine Lücken in der Myelinschicht) zum nächsten springt, was als saltatorische Erregungsleitung bezeichnet wird.
Myelinisierte Nervenfasern leiten Signale besonders schnell, mit Geschwindigkeiten von bis zu 120 Metern pro Sekunde. Im Vergleich dazu bewegt sich das Aktionspotenzial in unmyelinisierten Fasern kontinuierlich entlang des Axons und ist deshalb deutlich langsamer: Sie schaffen nur etwa 1 bis 3 Meter pro Sekunde.
Diese Unterschiede sind nicht nur theoretischer Natur – sie haben direkte Auswirkungen auf unser tägliches Leben. Zum Beispiel ermöglicht die schnelle Signalübertragung durch myelinisierte Nervenfasern blitzschnelle Reaktionen, wie das reflexartige Zurückziehen der Hand von einer heißen Herdplatte.

Wie die Information übertragen wird
Wenn das Aktionspotenzial das Ende des Axons erreicht, werden Neurotransmittern in den synaptischen Spalt – den winzigen Raum zwischen dem Neuron und der nächsten Zelle – freigesetzt. Diese Neurotransmitter binden an Rezeptoren auf der Oberfläche der nächsten Nervenzelle (oder einer anderen Zielzelle wie einer Muskelzelle), wodurch ein neues elektrisches Signal in dieser Zelle ausgelöst wird. Und das Spiel beginnt von vorne.
Nachdem die Neurotransmitter ihre Nachricht übermittelt haben, werden sie entweder wieder in das ursprüngliche Neuron aufgenommen, abgebaut oder von anderen Zellen entfernt, um den synaptischen Spalt für das nächste Signal zu »resetten«.

Was die Informationsübertragung beeinflusst
Dieser Prozess der Signalübertragung ermöglicht es dem Gehirn, Informationen blitzschnell zu verarbeiten, Entscheidungen zu treffen und den Körper zu steuern. Jedes Neuron kann Tausende von Verbindungen (Synapsen) zu anderen Neuronen haben, was die Komplexität und Effizienz des Nervensystems enorm erhöht.
Es gibt verschiedene Faktoren, die die Geschwindigkeit der Informationsweiterleitung beeinflussen können. Mit zunehmendem Alter oder bei neurologischen Erkrankungen kann die Myelinschicht abgebaut werden, was zu einer Verlangsamung der Signalübertragung führt. Dies kann Reaktionszeiten verlängern und kognitive Fähigkeiten beeinträchtigen.
Wie wir gesehen haben, sind es nicht nur die Neuronen allein, sondern auch ihre Wechselwirkungen und Verbindungen, die unser Gehirn so außergewöhnlich machen. Entscheidend sind auch die chemischen Botenstoffe, die Neurotransmitter: Sie geben Befehle an die Neuronen, Informationen zum und vom Gehirn und durch den gesamten Körper zu leiten.
Veränderungen im Gleichgewicht dieser Neurotransmitter können erhebliche Auswirkungen auf das Verhalten, die Stimmung und die kognitive Funktion haben. Hier sind einige Beispiele für die Auswirkungen solcher Veränderungen:

1. Dopamin
- Erhöhtes Dopamin: Kann zu Zuständen wie Schizophrenie oder Manie führen, die durch übermäßige Erregung und Halluzinationen gekennzeichnet sind.
- Vermindertes Dopamin: Ist häufig mit Parkinson-Krankheit verbunden, was zu motorischen Störungen, Zittern und Schwierigkeiten bei der Bewegung führt.
2. Serotonin
- Erhöhtes Serotonin: Zu viel Serotonin kann das Serotonin-Syndrom verursachen, eine gefährliche Erkrankung, die Unruhe, Verwirrung, erhöhten Puls und Blutdruck, Muskelzuckungen und sogar Krampfanfälle auslösen kann.
- Vermindertes Serotonin: Wird oft mit Depressionen, Angstzuständen und Schlafstörungen in Verbindung gebracht. Ein Mangel an Serotonin kann auch das Risiko für aggressive Verhaltensweisen erhöhen.
3. Noradrenalin (Norepinephrin)
- Erhöhtes Noradrenalin: Kann zu Symptomen wie erhöhter Herzfrequenz, Bluthochdruck, Angstzuständen und Panikattacken führen.
- Vermindertes Noradrenalin: Wird häufig mit depressiven Zuständen und niedriger Motivation assoziiert.
4. GABA (Gamma-Aminobuttersäure)
- Erhöhtes GABA: Führt zu beruhigenden Effekten und kann Angst reduzieren, aber auch zu übermäßiger Sedierung und Schläfrigkeit führen.
- Vermindertes GABA: Kann Angstzustände, Reizbarkeit und in extremen Fällen epileptische Anfälle auslösen.
5. Acetylcholin
- Erhöhtes Acetylcholin: Kann übermäßige Muskelkontraktionen, Krämpfe und vermehrte Speichelproduktion verursachen.
- Vermindertes Acetylcholin: Ist mit Alzheimer-Krankheit verbunden und führt zu Gedächtnisstörungen, Aufmerksamkeitsdefiziten und Lernschwierigkeiten.
Veränderungen in der Balance dieser und anderer Neurotransmitter können durch verschiedene Faktoren ausgelöst werden, darunter genetische Prädispositionen, Ernährung, Medikamente, Stress und Umwelteinflüsse.

Was wir für eine schnelle Signalübertragung tun können
Die Signalübertragung im Gehirn ist ein hochkomplexer Prozess, der von vielen Faktoren beeinflusst wird, darunter Ernährung, Lebensstil und Umwelt. Wenn du die Gesundheit des Gehirns und die Effizienz der neuronalen Kommunikation fördern willst, kannst du gezielt deine Neuronen und Neurotransmitter unterstützen:
1. Ernährung zur Unterstützung der Myelinisierung und Neurotransmitterproduktion
- Omega-3-Fettsäuren: Diese essentiellen Fettsäuren sind besonders wichtig für die Gesundheit der Myelinscheide, die das Axon von Neuronen umgibt und die Geschwindigkeit der Signalübertragung erhöht. Fette Fische wie Lachs, Makrele und Thunfisch sind reich an Omega-3-Fettsäuren. Auch Walnüsse und Leinsamen sind gute pflanzliche Quellen.
- Antioxidantienreiche Lebensmittel: Beeren, grünes Blattgemüse und Nüsse enthalten Antioxidantien, die die Gehirnzellen vor oxidativem Stress schützen. Freie Radikale können die neuronale Funktion beeinträchtigen und die Signalübertragung verlangsamen.
- B-Vitamine: Besonders B6, B9 (Folsäure) und B12 spielen eine entscheidende Rolle bei der Synthese von Neurotransmittern wie Serotonin und Dopamin. Diese Vitamine sind in Vollkornprodukten, Eiern und Hülsenfrüchten zu finden.
Lies mehr darüber: Steigere deine Gehirnleistung: Gib deinem Gehirn einen Boost mit BrainFood
2. Regelmäßige körperliche Aktivität
- Förderung der Neurogenese: Regelmäßige Bewegung, insbesondere Ausdauersportarten wie Laufen oder Schwimmen, fördert die Bildung neuer Neuronen (Neurogenese) im Hippocampus, einem Gehirnbereich, der für das Gedächtnis wichtig ist. Bewegung erhöht zudem die Durchblutung des Gehirns, was die Versorgung der Neuronen mit Sauerstoff und Nährstoffen verbessert.
- Reduktion von Entzündungen: Körperliche Aktivität reduziert chronische Entzündungen im Körper, die die Funktion von Neuronen beeinträchtigen und die Signalübertragung verlangsamen können.
Hier findest du noch mehr Infos: Entfessle die Kraft eines fitten Gehirns: Entdecke, wie Bewegung deine geistige Fitness steigert!
3. Stressmanagement
- Balance der Neurotransmitter: Chronischer Stress erhöht die Produktion von Cortisol, einem Hormon, das die Signalübertragung im Gehirn negativ beeinflussen kann. Techniken wie Meditation, Achtsamkeitstraining und tiefe Atemübungen helfen, Cortisolspiegel zu senken und das Gleichgewicht der Neurotransmitter aufrechtzuerhalten.
- Mehr und längere Entspannungsphasen: Regelmäßige Entspannungsphasen, wie sie durch Yoga oder Tai Chi gefördert werden, unterstützen die Regeneration der Neuronen und verbessern die neuronale Plastizität, also die Fähigkeit des Gehirns, sich an neue Informationen und Erfahrungen anzupassen.
Mehr Infos und Tipps findest du hier: Nie wieder Stress!
4. Kognitive Herausforderungen und Lernaktivitäten
- Stärkere neuronale Verbindungen: Mentale Herausforderungen, wie das Erlernen einer neuen Sprache, das Lösen von Rätseln oder das Spielen von Instrumenten, fördern die Bildung und Stärkung neuer synaptischer Verbindungen. Dies verbessert die Effizienz der Signalübertragung zwischen den Neuronen.
- Anregung der Neuroplastizität: Durch ständige kognitive Aktivität bleibt das Gehirn flexibel und anpassungsfähig, was die Verarbeitungsgeschwindigkeit von Informationen verbessert.
Wusstest du, dass Lernen die Struktur deines Gehirns verändert?
5. Schlafhygiene
- Regeneration der Neuronen: Ausreichender und erholsamer Schlaf ist entscheidend für die Regeneration von Neuronen und die Konsolidierung von Gedächtnisinhalten. Während des Schlafes durchläuft das Gehirn Phasen intensiver neuronaler Aktivität, die die Signalübertragung und den Erhalt von Verbindungen stärkt.
- Tiefschlafphasen: Diese Phasen sind besonders wichtig für die Entfernung von Abfallprodukten aus dem Gehirn, die sich tagsüber ansammeln. Ein regelmäßiger Schlaf-Wach-Rhythmus unterstützt diese Prozesse optimal.
Wie du besser schlafen kannst, liest du hier: 9 effektive Tipps für erholsamen Schlaf – weil Schafe zählen überbewertet ist
Mit diesen praktischen Tipps kannst du dein Gehirn gesund halten und die neuronale Signalübertragung ankurbeln. Ein gesunder Lebensstil, der auf ausgewogener Ernährung, regelmäßiger Bewegung, Stressmanagement und ausreichendem Schlaf basiert, ist entscheidend für ein optimal funktionierendes Gehirn.
Ein Gedanke noch am Schluss
Was noch erstaunlicher ist, ist dass unsere Gehirne ständig verändern, lernen und sich anpassen. Es ist ein ständiges Wachstum und Umbau, damit wir uns an die Herausforderungen und Anforderungen des Lebens anpassen können. Es ist ein schönes Beispiel für die Wunder der Natur, und doch gibt es immer noch so viel mehr zu lernen und zu entdecken.
Noch mehr faszinierende Fakten über unser wunderbares Gehirn, findest du hier:
Wusstest du, dass 60% des menschlichen Gehirns aus Fett bestehen?
Wusstest du, dass sich das menschliche Gehirn noch bis zu deinem 25. Lebensjahr entwickelt?